Die Uferpromenade ziert ein
hufeisenförmiges Kino, dessen zylindrische Front sich dem Meer
entgegenwölbt. Unweit des ehemaligen Hotels Roma ragen die hohen,
schmalen Arkaden der Grundschule empor, an die sich wie ein Ufo ein
rundes Atrium anschließt. Eines der architektonisch kühnsten Gebäude ist
das Ensemble der elliptischen Markthalle mit viereckigem Uhrenturm, bei
dem rechte Winkel, kubische und Kreisformen eine gewagte, aber
harmonische Synthese eingehen.

Der Ort beginnt
sich herauszuputzen. Doch viele Gebäude dämmern dem Zerfall entgegen.
Dennoch ist George Trampoulis, der Leiter des historischen Archivs von
Leros, der Ansicht, Lakki verdiene es, in die Liste des Unesco-Welterbes
aufgenommen zu werden. Trampoulis argumentiert mit den baulichen und
historischen Besonderheiten der in den dreißiger Jahren errichteten
Architektur. Lakki ist die einzige Stadt außerhalb Italiens, die als
funktionsfähige Einheit im Stil des Rationalismus geplant und errichtet
wurde. Diese italienische Variante der Klassischen Moderne, die sich
durch Minimalismus und Funktionalismus auszeichnet, darf in einem
Atemzug mit Mies van der Rohes Weißenhofsiedlung in Stuttgart genannt
werden. Doch während die Wohnsiedlung des deutschen Werkbundes wegen
ihrer weißen Dachterrassen als „Araberdorf“ verspottet wurde und Hitler
sie abreißen lassen wollte, entwickelte sich die „Architettura
Razionale“ unter Benito Mussolini zu einer Hauptströmung in der italienischen Architektur und zur vorherrschenden Stilrichtung des Faschismus.

Vormachtstellung in der Ägäis
Vorhersehbar war das nicht. Im Gegensatz
zum nationalsozialistischen Deutschland hatte das faschistische Italien
lange keine einheitliche Kultur- und Kunstideologie. Unterschiedliche
Architekturströmungen bekämpften einander. Noch in den zwanziger Jahren
dominierten verschiedene Ausprägungen des Historismus. Eine Gruppe
junger italienischer Architekten war es, die diese Bauweisen angesichts
der technischen und industriellen Entwicklung des frühen zwanzigsten
Jahrhunderts als nicht mehr zeitgemäß empfand. Sie forderte eine
Rückbesinnung auf die geometrischen Formen der Antike. Baumaterialien
wie Beton, Stahl und Glas sollten Transparenz und Funktionalität
unterstreichen. Damit war die Bewegung der Architettura Razionale
begründet.

Als
Paradebeispiele für sie gelten Musterstädte wie Sabaudia, Pontinia oder
Pomezia südlich von Rom. Sie zeichnen sich durch monumentale Gebäude mit
schmucklosen Fassaden aus, die einer strengen Geometrie gehorchten und
entlang axialer Straßen und großer Plätze angeordnet waren. Auch auf den
Inseln des Dodekanes und in den ehemaligen afrikanischen Kolonien der
Italiener finden sich zahlreiche Beispiele rationalistischer
Architektur. Doch wie kam es, dass fern von Rom eine ganze Stadt in
diesem Stil aus dem Boden gestampft wurde?

Nach
Jahrhunderten unter osmanischer Herrschaft gingen die Dodekanes-Inseln
1923 in den Besitz des Königreichs Italien über. Mussolini betrachtete
die Inselgruppe als wichtigen Standort zur Sicherung seiner
Vormachtstellung in der Ägäis. Lakki war damals ein unbedeutendes Dorf
in sumpfiger Gegend; der Ort besaß aber den größten natürlichen Hafen im
östlichen Mittelmeer, der sich hervorragend für militärische Zwecke
eignete. Mussolini ließ ihn zu einem zentralen Flottenstützpunkt mit
Fliegerbasis ausbauen. Parallel entstand die Stadt Lakki. An ihrer
Grundstruktur hat sich bis heute nichts geändert. In Hafennähe liegt der
Wirtschafts- und Geschäftsbezirk mit Kino, Hotel und Markt. Dahinter
erstrecken sich die Wohnviertel, in denen die italienischen Arbeiter,
Offiziere und Unteroffiziere ihre Quartiere hatten. Der Ort, geplant für
einige tausend Menschen, erhielt ein Krankenhaus, eine Kirche und hieß
fortan nicht mehr Lakki, sondern – wohl in Anspielung auf das riesige
Hafenbecken – Porto Lago.

„Lakki ist zwar
im rationalistischen Stil erbaut, jedoch nicht vergleichbar mit Städten
wie Sabaudia“, urteilt Trampoulis. Die Architektur erreiche hier ein
viel höheres Maß an Individualität und Gestaltungsvielfalt als in
Italien. „Vermutlich verschaffte die große Entfernung zu Rom den
Städtebauern mehr Freiräume und Möglichkeiten zum Experimentieren“,
meint er. Ähnlich äußerte sich der griechische Architekt Anthony C.
Antoniades schon in den achtziger Jahren. Antoniades schrieb damals, die
Gebäude von Lakki sollten als glücklicher Unterschied zu den zentralen
Positionen und Praktiken in ihrer dezentralen Kreativität und relativen
Freiheit betrachtet werden.

Antoniades verlangte auch, endlich die
rationalistische Architektur als solche zu würdigen statt sie nur mit
dem Faschismus gleichzusetzen. Architekturkritiker diskutieren freilich
weiterhin darüber, ob es angemessen sei, Bauten unter rein ästhetischen
Gesichtspunkten zu beurteilen, ohne die mit ihnen verknüpfte Ideologie
zu berücksichtigen.

Eindeutig fiel
jedoch die Reaktion der einheimischen Bevölkerung aus, nachdem die
Inselgruppe 1947 an Griechenland abgetreten wurde. Für die Menschen war
zunächst alles, was mit italienischer Architektur zu tun hatte, mit
ihren Erfahrungen unter dem italienischen Faschismus verbunden. Diese
extreme Ablehnung erklärt sich nicht zuletzt durch die Figur des Cesare
Maria De Vecchi, der ab 1936 Gouverneur auf den Dodekanes war. Mit
seiner aggressiven Italianisierung brachte er die Bevölkerung gegen sich
auf. Er erklärte Italienisch zur offiziellen Sprache, entzog den
Einheimischen das Wahlrecht. Außerdem setzte De Vecchi die
antisemitischen Rassengesetze auf den Dodekanes um. Als er 1940 die
Inseln verließ, blieben vor allem Ressentiments gegen alles, was mit ihm
in Verbindung gebracht wurde. Mit der Folge, dass auch die
rationalistischen Gebäude von Lakki verrotteten.



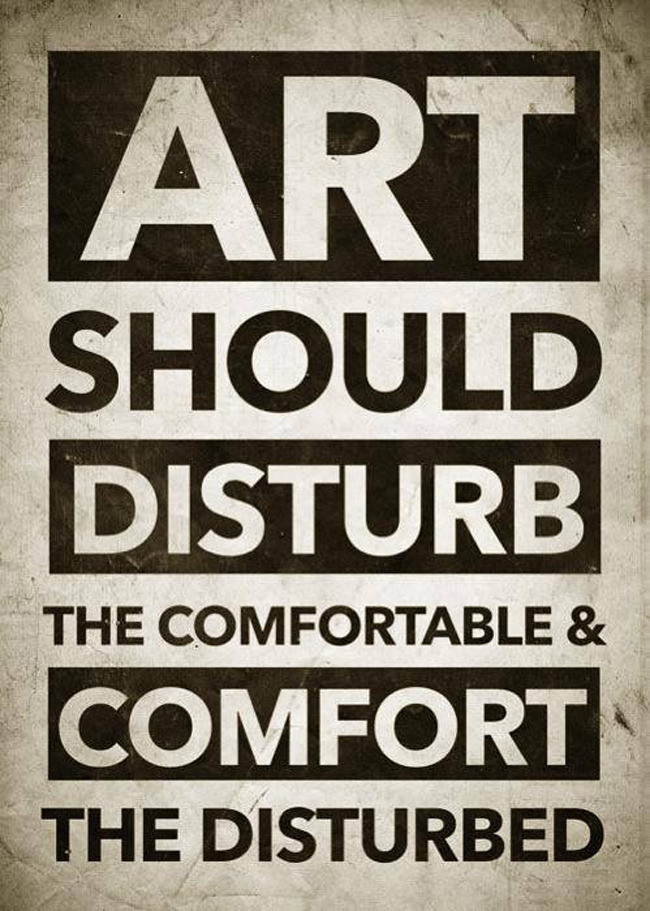













 von
Martin Kugler
von
Martin Kugler


















