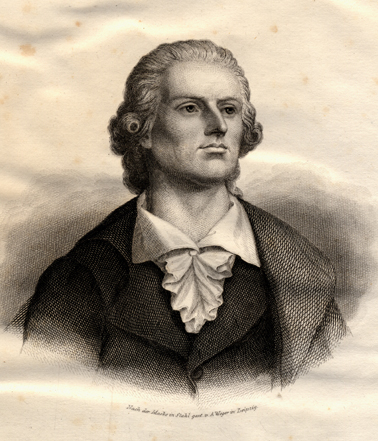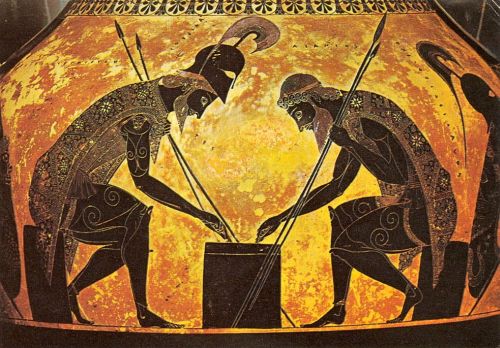Unser Zeitgenosse Vincent In Arles glühte Vincent van Goghs Palette 1888 auf. Eine ambitionierte, finanzkräftige Stiftung beleuchtet daselbst nunmehr sein Schaffen – aus der historischen wie aus der heutigen Perspektive.
Als Vincent van Gogh am 20. Februar 1888 im sonnigen Süden ankam, war der Himmel bleifarben und das Thermometer unter null. Durch das verschneite Arles, ursprünglich bloss als Zwischenstation auf dem Weg nach Marseille gedacht, wirbelte der Mistral eisige Böen. Das erste Bild, das der Paris-müde Niederländer hier malte, hätte auch in Montmartre entstehen können: das Schaufenster einer Fleischerei, von einem Restaurant aus gesehen. Doch dann kam der Frühling – und alles ganz anders. Van Gogh blieb in Arles, 444 Tage lang. Seine Palette glühte auf. Hier schuf er den farbigsten, strahlendsten Teil seines Werks: die Sonnenblumen, die blühenden Obstgärten und die «Sternennacht über der Rhône»; das «Gelbe Haus», das «Nachtcafé» und die «Caféterrasse am Abend»; Ansichten des Pont Langlois, der Alyscamps-Nekropole, des Fischerdorfes Saintes-Maries-de-la-Mer; Allegorien wie die Sämanns-Bilder, hintersinnige Stillleben wie «Vincents Stuhl» und «Gauguins Sessel», Porträts wie «La Berceuse», «La Mousmé» und «Le Zouave», die Selbstbildnisse mit verbundenem Ohr nicht zu vergessen . . .
L’impasse des deux frères, 1887; Paris (Montmartre)
Neugegründete Stiftung
Doch keines der rund 200 Gemälde sowie 100 Zeichnungen und Aquarelle ist heute noch in Arles. Man kann das eine Form von höherer Gerechtigkeit nennen, fand der Maler – in seinen luziden Momenten – die Stadt doch dreckig und ihre Einwohner faul und geldgeil. Die Kinder hänselten den rothaarigen Sonderling, die Erwachsenen tippten sich, wenn sie ihm auf der Strasse begegneten, vielsagend an die Schläfe oder gafften ihm gar durchs Fenster ins Atelier. Ein Jahr nach seiner Ankunft führte eine Petition von dreissig Nachbarn zur Zwangsinternierung des Mieters der «Maison jaune».
Die Krise, während deren sich der geistig zerrüttete Maler einen Teil des linken Ohrs abgetrennt hatte, lag da schon zwei Monate zurück. Bis zu seiner Überweisung in die Irrenanstalt von Saint-Rémy-de-Provence im Mai 1889 sollte er das Spital von Arles kaum mehr verlassen.
 Guillaume Bruère: «Ohne Titel», Louvre, 29. Juni 2011, Ölkreide und Bundstift auf Papier, 70 × 50 cm, Privatsammlung.(Fondation van Gogh, Arles)
Guillaume Bruère: «Ohne Titel», Louvre, 29. Juni 2011, Ölkreide und Bundstift auf Papier, 70 × 50 cm, Privatsammlung.(Fondation van Gogh, Arles)Anderseits war, wie Steven Naifeh und Gregory White Smith in ihrer Standardbiografie schreiben, van Goghs Bildschaffen während dieser 444 Tage «das produktivste, überzeugendste und letztlich entscheidendste seiner Laufbahn». Daran musste vor Ort einfach erinnert werden. Ein Verein unter der Leitung von Yolande Clergue, der rührigen Gattin des Fotografen und Gründers der Rencontres d'Arles, Lucien Clergue, hatte seit 1988 ambitionierte Ausstellungen organisiert. Doch streckte vor ein paar Jahren der Fiskus seine Krallen nach ihm aus – das Ende drohte. Rettung kam in Gestalt der beiden guten Feen von Arles, eines Enkels und einer Grossenkelin des Schweizer Pharma-Unternehmers Fritz Hoffmann-La Roche. Luc Hoffmann besänftigte den Steuerdrachen, verwandelte den Verein 2010 in eine gemeinnützige Stiftung, erwirkte von der Stadtverwaltung für vierzig Jahre die Nutzung eines Gebäudes in zentraler Lage und spendierte die 11 Millionen Euro für den Umbau. Seine Tochter, Maja, übernahm die Leitung des künstlerischen Rats und vermochte die international renommierte Kuratorin Bice Curiger als Direktorin zu gewinnen.
japanische Drucke, von denen van Gogh rund 50 in Paris gekauft und selber ausgestellt hat (viel Hiroshige)
Am 7. April wurde die Fondation Vincent van Gogh Arles eröffnet. Das ehemalige Hôtel particulier, in dem sie untergebracht ist, geht ins 15. Jahrhundert zurück und wurde mehrfach umgenutzt. Entsprechend heterogen wirkt der Baubestand: Die Fenster reichen von der Gotik über Renaissance und 18. Jahrhundert bis zur Jetztzeit; der Parcours führt via Gänge, einen überdachten Innenhof und Treppen vom Erdgeschoss zur Dachterrasse; die 1000 Quadratmeter Ausstellungsfläche sind auf nüchtern-moderne Museumssäle wie auf Kabinettchen mit Parkett, Cheminée und Holztäfelungen verteilt. Das Architekturbüro Fluor hat seine Aufgabe insofern erfüllt, als der Bau nicht nur funktional, sondern auch licht und heutig wirkt.
Am 7. April wurde die Fondation Vincent van Gogh Arles eröffnet. Das ehemalige Hôtel particulier, in dem sie untergebracht ist, geht ins 15. Jahrhundert zurück und wurde mehrfach umgenutzt. Entsprechend heterogen wirkt der Baubestand: Die Fenster reichen von der Gotik über Renaissance und 18. Jahrhundert bis zur Jetztzeit; der Parcours führt via Gänge, einen überdachten Innenhof und Treppen vom Erdgeschoss zur Dachterrasse; die 1000 Quadratmeter Ausstellungsfläche sind auf nüchtern-moderne Museumssäle wie auf Kabinettchen mit Parkett, Cheminée und Holztäfelungen verteilt. Das Architekturbüro Fluor hat seine Aufgabe insofern erfüllt, als der Bau nicht nur funktional, sondern auch licht und heutig wirkt.
Les Saintes Maries de la Mer, 1888 (Freiluft)
Vor allem bei Sonnenwetter, wenn unter dem Glasdach der Buchhandlung die 78 bunten Scheiben von Raphael Heftis Installation «La Maison violette bleue verte jaune orange rouge» vielfarbige Flecken auf den Betonboden vor den Museumssälen zaubern. Die Anspielung auf «La Maison jaune» ist klar, wie denn auch alle übrigen in der Eröffnungsausstellung «Van Gogh live!» gezeigten zeitgenössischen Werke von Guillaume Bruère, Fritz Hauser, Camille Henrot, Thomas Hirschhorn, Gary Hume, Bethan Huws und Elizabeth Peyton einen Bezug zum Namensgeber der Stiftung herstellen. Einige tun das freilich stichhaltiger und stimmungsvoller als andere, zuvörderst Bruères nervöse, zittrige, in quasi schamanischer Ekstase hingeworfene Zeichnungen nach Werken «grosser Meister», darunter ein «Selbstbildnis mit verbundenem Ohr».
Hütten in Les Saintes Maries, 1888 (im Atelier)
Leihgaben von Weltrang
Schon der Verein, aus dem die Fondation hervorgegangen ist, förderte die Auseinandersetzung lebender Künstler mit van Goghs Werk. Damit machte er aus der Not eine Tugend, waren Originale doch zunehmend schwer zu haben. Heute ist das etwas anders: Wohl auch dank der Finanzkraft der Hoffmanns konnte mit dem Van-Gogh-Museum in Amsterdam ein Fünfjahresvertrag geschlossen werden, der neben dem Verleih von Gemälden und Zeichnungen für die je übliche Dauer von fünf bzw. drei Monaten auch die ganzjährige Entsendung eines einzelnen Bildes vorsieht, heuer das «Selbstporträt mit Strohhut und Pfeife». Van Gogh ist also wieder in Arles, dauerhaft.

Vincent van Gogh: «Selbstbildnis mit Pfeife und Strohhut», 1887, 41,9 × 30,1 cm, Van Gogh Museum, Amsterdam.(Fondation van Gogh, Arles)
Damit nicht genug, wird Sjraar van Heugten, ehemaliger Chefkonservator des Van-Gogh-Museums, drei «historische» Ausstellungen kuratieren. Die erste zeichnet zurzeit als zweite Eröffnungsschau die Entwicklung von van Goghs Farbpalette nach. Eine sehr seriöse, didaktische Schau, die mit Leihgaben von Weltrang («La Maison jaune», «Le Zouave» . . .) und einem mustergültigen Katalog besticht. Laut Curiger wird das Ausstellungsangebot drei- bis viermal jährlich wechseln, wobei mindestens eine Schau Werke von van Gogh enthalten soll. 2015 werden das Zeichnungen sein, 2016 sogar mindestens vierzig (!) Originale. «Van Goghs künstlerisches Werk», so die Direktorin, «seine kunsthistorische Rezeption und seine Ausstrahlung als kunstsoziologisches Phänomen bieten so viele Ansatzpunkte, dass wir spielend in den nächsten Jahren Ausstellungen mit direktem Bezug planen können. Aber dieser soll sich nicht in trivialen Motiv- oder Stil-Analogien erschöpfen. Unsere Arbeit soll durchaus auch die ‹Konventionen› der Kunstgeschichte und des Museumsbetriebs herausfordern.» Man darf gespannt sein . . .
Bis 31. August. Kataloge: Sjraar van Heugten (Hrsg.): Van Gogh. Couleurs du Nord, couleurs du Sud. Actes Sud, Arles 2014. 120 S., € 30.–. Bice Curiger (Hrsg.): Van Gogh live! Analogues, Arles 2014. 224 S. € 32.–.
aus der Ausstellung; mit Bildern u. a. von Courbet, Corot und Daubigny
Nota.
Zu meinen Hausgöttern gehört van Gogh noch immer nicht. Lange hatte ich eine richtige Abneigung: In den fünfziger Jahren sah man diese Öldrucke überall, Fischerboote, Zugbrücken, Sternenhimmel, Sonnenblumen, Strohhüte... Und alles in fingerdricken parallelen Pinselstrichen, die man noch auf den Reproduktionen glaubte befühlen zu können. Mit andern Worten, den "richtigen" van Gogh, der in Arles endlich die Manier heraus- gefunden hat, nach der er jahrelang so verzweifelt gesucht hatte - viele Pariser Bilder zeugen davon, aber die werden sie in Arles kaum zeigen:
Wo er aber darauf verzichtet, die Farben, die Pinselführung, die Weisen des Farbauftrags unabhängig vom Motiv vorab festzulegen, kommt gelegentlich etwas Selbstständiges heruas:

Man erkennt, dass er für das Handwerk, das er gewählt hat, Talent hat, und das war bei seinen holländischen Bildern nicht immer so. Solange er aber in Paris war, meinte er wohl, mit Monet & Co. um Originalität wetteifern zu sollen, da war es gut, dass er in die Provence weiterzog. Da hat er sich sozusagen freigepinselt. Er hat gemalt wie ein... Berserker, wollt ich sagen, und die Springflut der "richtigen" van Goghs lässt vergessen, dass er ja nur einuneinviertel Jahr dort unten war. So lange darf man schon mal eine Manier kultivieren, die man selber erfunden hat, und nur die Hälfte ist gestelzt, es kommen auch ganz individuelle Lösungen vor:
Und schließlich war es ihm selber leid; die ewiggleiche Beleuchtung in der Provence, die immer wieder sich einschleichende vanGogh-Manier... Er hat sein Arbeitstempo in Auvers überhaupt nicht verlangsamt, im Gegenteil, anderthalb Bilder pro Tag! Und deutlich sichtbar wird, dass er im Begriff war, sich von sich selbst zu emanzipieren. Das zeigen sie in Arles natürlich nicht.
Wirklich schade, dass er so früh gestorben ist, das wird man ja wohl noch sagen dürfen.
JE