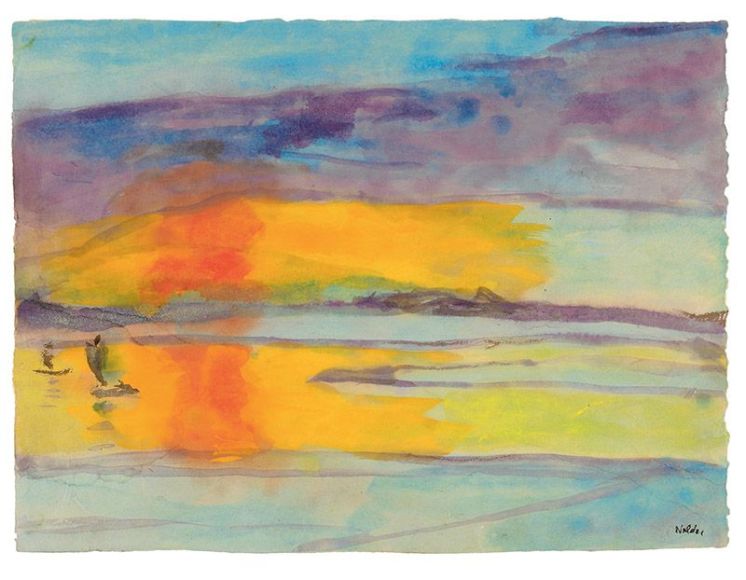aus Neue Zürcher Zeitung, 30. Januar 2010 Paul Cézanne, La carrière de Bibémus, 1895
Zum Verhältnis von Diskurs und Malerei
Noch in der Gotik war die Schrift selbstverständlich Teil der Malerei. In den illusionistischen Bildräumen der Renaissance aber hatte sie keinen Platz mehr. Das änderte sich erst wieder mit der Kunst der Moderne, in der die Schrift auf neue Weise wieder auftaucht – nicht immer in eindeutiger Art allerdings.
Von Peter Bürger
Geprägt durch die Moderne, wie wir sind, erscheint uns alles Diskursive, d. h. das Gegenständliche und das Erzählende, immer noch als etwas der Malerei Fremdes – und dies obwohl mit Pop-Art und Neuen Wilden der Gegenstand und seither auch die Erzählung in die Malerei zurückgekehrt sind. Wie eng einst die Verschränkung von Bild und Schrift war, ist für uns daher schwer nachzuvollziehen.
Die religiöse Malerei des Mittelalters hatte die Bibel zur Voraussetzung. Sie war Darstellung biblischer Geschichten, die der Betrachter im Bild wiedererkannte. Allenfalls nebenher mag er die Schönheit der Komposition bewundert haben, vor allem ging es ihm darum, die Bedeutung des Dargestellten zu erfassen. Von der Verschränkung von Bild und Schrift zeugen in der gotischen Malerei nicht zuletzt die lesende Maria in der Verkündigung oder die Heiligen mit der Bibel in der Hand, aber auch das Motiv des die Madonna malenden Lukas, in dem der des geschriebenen Worts mächtige Evangelist als Maler erscheint.
Jan Gossaert-Mabuse, Der Hl. Lukas malt die Jungfrqu Maria
Störender Fremdkörper
Für die gotischen Maler ist das Bild so selbstverständlich Wiedergabe der Schrift, d. h. der Heiligen Schrift, dass sie Schriftzeichen ins Bild hineinnehmen, sei es als Spruchband, das zwischen dem Übersinnlichen und dem Irdischen vermittelt, zwischen dem Verkündigungsengel und Maria, sei es als Schriftzug mit dem Namen der dargestellten Heiligen. Das ändert sich erst in der Renaissance mit der Einführung des perspektivischen, auf den Blickpunkt des Betrachters ausgerichteten Bildraums. Jetzt wird das Bild zur illusionistischen Darstellung einer Szene. Es wird nicht mehr vornehmlich als Teil der unabgeschlossenen Heilsgeschichte gelesen, sondern als eine in sich abgeschlossene ästhetische Ganzheit betrachtet.
Das hat Konsequenzen für die Anwesenheit von Schrift im Bild. Diese muss nun motiviert werden (z. B. als Seite in einem aufgeschlagenen Buch), andernfalls würde sie vom Betrachter als ein die Illusion störender Fremdkörper empfunden. Diese Konstellation gilt weitgehend auch für die auf die Renaissance folgenden Jahrhunderte, in denen sich zunächst noch innerhalb des Historienbildes die neuen Gattungen des Stilllebens und der Landschaftsmalerei herausbilden. Da diese an die perspektivische Raumauffassung gebunden bleiben, schliessen sie die nicht motivierte Integration von Schrift in das Bild aus.
 Botticelli, Zenobius wird getauft und zum Bischof geweiht, 1500 - 05
Botticelli, Zenobius wird getauft und zum Bischof geweiht, 1500 - 05 Erst als Georges Braque und Pablo Picasso in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg, ausgehend von einigen Landschaften des späten Cézanne, in denen der Raum keine Tiefe mehr zu haben scheint, sich von dem perspektivisch auf den Blickpunkt des Betrachters hin orientierten illusionistischen Raum verabschieden, tritt auch, was die Schrift im Bild angeht, eine Änderung ein. Indem die beiden Maler in der Phase des analytischen Kubismus ein Vokabular aus Flächenfacetten entwickeln, in denen unterschiedliche Ansichten des Gegenstands aufscheinen, leiten sie eine Revolution des seit der Renaissance geltenden Darstellungssystems ein. Gleichwohl behalten sie den Bezug zur Realität bei, wenn dieser auch nicht mehr in der gewohnten perspektivischen Sicht ins Bild tritt.
Gefahr der Verarmung
Nachdem so die Illusion, die seit der Renaissance die Malerei dem Betrachter vermittelte, aufgesprengt ist, kann nun auch die Schrift wieder ins Bild hineingenommen werden. Das geschieht im Kubismus durch die Einfügung von Buchstaben und Wortfragmenten, die als Formelemente eingesetzt werden, zugleich aber die Assoziationen des Betrachters auf den Gegenstand lenken, der in der deformierenden Darstellung nicht mehr unmittelbar erkennbar ist.
Braque, Geige und Krug
In der Geschichte der modernen Malerei nimmt der Kubismus eine herausragende und zugleich paradoxe Stellung ein. Einerseits zerstört er ein Darstellungssystem, das 500 Jahre in Geltung gewesen ist, und ersetzt es durch ein anderes; andererseits schreckt er davor zurück, den Schritt zur gegenstandslosen Malerei zu vollziehen, der in den gegeneinander verschobenen und ineinander verkeilten Flächen des analytischen Kubismus angelegt schien. Man wird diese Entscheidung kaum überbewerten können, deutet sie doch darauf hin, dass Picasso und sein Mitstreiter Braque offenbar in der Preisgabe des Realitätsbezugs, und damit der Diskursivität des Bildes, die Gefahr einer Verarmung der Malerei sahen. In der Tat wird durch den in der Entwicklungslogik der modernen Malerei liegenden Schritt zur Gegenstandslosigkeit diese ja nicht nur von allem «Nicht-Malerischen» befreit, so dass sie sich ganz auf die ihr eigenen Mittel, Linie, Fläche, Farbe und Form, konzentrieren kann, sondern sie verliert auch etwas ihr Wesentliches: nämlich das Wechselspiel zwischen Darstellung und Dargestelltem, Schein und Wirklichkeit. Dieses Wechselspiel ist es, das den Blick des Betrachters belebt und Bedeutungszuweisungen ebenso ermöglicht wie die Konzentration auf die künstlerischen Mittel.
Arnold Gehlen hat in «Zeit-Bilder» schon 1960, auf dem Höhepunkt des Informel, erkannt, dass die Gegenstands- losigkeit die moderne Malerei vor erhebliche Probleme stellt, eben weil sie ihr den Wirklichkeits-Pol nimmt. Das abstrakte Bild, so seine These, sei in einem bisher nicht gekannten Sinne «kommentarbedürftig». Der aus dem Bild vertriebene Gegenstand siedle sich neben dem Bild als Begleittext an. In der Tat kann der Betrachter eines abstrakten Bildes nicht mehr zwischen Darstellung und Dargestelltem hin- und hergehen, er nimmt daher seine Zuflucht zum Kommentar. Was er dort findet, lässt sich aber schwer auf die Formenwelt des Bildes beziehen, Aus der Kluft zwischen den im Bild selbst nicht mehr vermittelten Ebenen der Farben und Formen einerseits und des Diskurses andererseits resultiert dann beim Betrachter der Eindruck der Beliebigkeit des Kommentars, der gleichwohl von der Abwesenheit des Gegenstands im Bild herbeizitiert wird.
Antoni Tàpies
Bilder ohne eigene Bedeutung
Nicht nur die Kubisten, auch bedeutende Maler aus der Zeit des Informel haben diese Problematik gespürt und daraus die Konsequenz gezogen, den Bezug zur Welt des Gegenstands und damit des Begriffs niemals ganz aufzugeben. So hat Antoni Tàpies Gegenstände in den noch feuchten Malgrund gepresst und Buchstaben und Zeichen ins Bild gesetzt, um dadurch Anhaltspunkte für eine semantische Deutung seiner Arbeiten zu geben.
Auch gegenstandslose Kunst lässt sich deuten. Da aber die Deutung nur am Verfahren ansetzen kann und dieses, nachdem der Maler es einmal entwickelt hat, kaum mehr Veränderungen unterliegt, lässt sich der Gehalt des Einzelwerks nicht bestimmen. Denn es ist die Anwesenheit des Diskurses im Bild, sei es als Erzählung, sei es als Gegenstand, die es ermöglicht, dem Einzelbild eine kommunizierbare Bedeutung zuzusprechen. Zwar vermögen Marc Rothkos vor einem monochromen Hintergrund schwebende Rechtecke oder Graubners Farbkissen beim Betrachter eine starke, wenngleich unbestimmte Stimmung auszulösen, und sie können ihn auch in eine meditative Versenkung versetzen, dem einzelnen Bild aber kommt keine nur ihm eignende Bedeutung zu.
Rothko
Bedeutungsaufladung
Gibt es aus der strukturellen Bedeutungsarmut des gegenstandslosen Bildes einen andern Ausweg als den Kommentar, der das angesprochene Problem schon deshalb nicht zu lösen vermag, weil er nicht in das Bild integriert ist? Man kann Cy Twomblys Verfahren, den Graphismen, aus denen seine Bilder bestehen, den Bildtitel als flüchtig hingeworfenen, aber lesbaren Schriftzug hinzuzufügen, als Versuch auffassen, dadurch das einzelne Bild mit einem besonderen Bedeutungsgehalt aufzuladen. Freilich, der Betrachter, der den Schriftzug «VIRGIL» zum Anlass nimmt, um in dem Bild nach Verweisen auf den römischen Dichter zu suchen, wird enttäuscht. Offenbar vertraut der Künstler darauf, dass der am oberen Bildrand verstümmelt, in der Bildmitte aber deutlich identifizierbare Name des römischen Dichters Gedanken an dessen Werk oder sogar Vorstellungen von der Kultur des Augusteischen Zeitalters beim Betrachter evoziert. Aber welche Gedanken? Welche Vorstellungen?
Cy Twombly, Virgil
Roland Barthes glaubt in den Schriftzügen des Bildes eine Anspielung auf eine Zeit altmodischer, in Musse betriebener Studien herauslesen zu können, entdeckt eine Nähe des Malers zum Zen-Buddhismus und in seinen Bildern einen «Mittelmeer-Effekt». Dergleichen Deutungen gehen über den Status von Einfällen nicht hinaus. Sie mögen anregend wirken, lösen aber das Problem nicht, dass dem Verlangen nach einer spezifischen Bedeutung des Bildes hier nur eine ganz unbestimmte, aus subjektiven Assoziationen bestehende Erfüllung zuteil wird.
Um Missverständnisse zu vermeiden, sei betont, dass natürlich von dem Maler kein Panorama des Augusteischen Zeitalters erwartet wird. In Cy Twomblys «VIRGIL» fehlt aber ein wie immer auch reduziertes Zeichen, das dem Betrachter ermöglichen würde, das Bild sowohl aus seiner Form wie aus gegenständlichen Verweisen heraus zu deuten. Der kulturell überdeterminierte Name im fast leeren Bildraum treibt den Kommentar entweder in falsche Bestimmtheit oder in schlechte Allgemeinheit. Dass der Maler seinem Bild einen Namen einschreibt, der eine Erzählung verspricht, sich aber mit dem blossen Schriftzug begnügt, dürfte sich letztlich von der modernistischen Dogmatik herleiten, die den Gegenstand als ein der Malerei fremdes Element aus dem Bild verbannt.
Komplexe Beziehung
Welche Möglichkeiten die Integration von Schrift ins Bild für eine Malerei bietet, die sich nicht mehr den von der Moderne aufgerichteten Tabus unterwirft, lässt ein Blatt von Schwontkowski erkennen. Wie Cy Twombly integriert auch er Schriftzüge ins Bild, aber anders als bei dem Wahlitaliener treten sie bei ihm mit figürlichen und dinglichen Zeichen in eine komplexe Beziehung, die sogar die Darstellung des Nicht-Darstellbaren erlaubt.
Das Blatt «Reception» wird von einer schwarzen Umrisszeichnung beherrscht, die sich etwas oberhalb der Bildmitte befindet: einem leicht schräg nach oben schauenden Profil, das mit Nase und Stirnansatz eine herunterhängende Glühbirne berührt. Der wie die Inschrift unter einem Emblem wirkende Schriftzug «40 WATT» und die am linken Bildrand von oben nach unten zu lesende Buchstabenreihe «HÔTEL» bilden in ihrer banalen Alltäglichkeit einen verstörenden Kontrast zu dem Pathos des zurückgeneigten Kopfes. Aber während der Betrachter sich an das einfache Pariser Hotelzimmer erinnert, in dem er als Student gewohnt hat, entdeckt er die Goldspuren an den Buchstaben des Titels.
Norbert Schwontkowski
Jetzt bemerkt er auch, dass der goldgelbe Grund des Blattes auf den Goldgrund gotischer Altartafeln anspielt. Und mit einem Mal wird ihm bewusst, dass der englische Titel nicht auf den Empfangstresen eines Hotels verweist, sondern auf den Empfang einer geistigen Botschaft. Die karge Hotel-Situation wäre dann nur der Ort, wo sich ein Geschehen anderer Ordnung ereignet. Das Blatt behauptet nicht, dass es in unserer geistfeindlichen Zeit noch spirituelle Erfahrungen gibt, aber es deutet die Möglichkeit an, dass wir uns erneut mit Hilfe von Bildern über unsere Welt verständigen.
Prof. Dr. Peter Bürger hat bis 1998 an der Universität Bremen Literaturwissenschaft und ästhetische Theorie gelehrt.
Vilhelm Hammershøi, Wohnzimmer
Nota. - Versuchen wir mal ganz vorsichtig, uns dem Thema zu nähern. Lassen Sie's mich so sagen: Ich glaube, man wird der künstlerischen Intention Cy Twomblys nicht gerecht, wenn man über seine Werke - und namentlich dieses - so viele Worte macht. Mit Norbert Schwontkowski mag das anders sein, viel habe ich von ihm noch nicht gefunden. Worte machen ist aber das Geschäft sowohl der Kunsthistoriker als auch der ästhetischen Theorie.
Bleibt die Frage, ob es so viele sein müssen.
Im vorliegenden Fall: Der Text ist bloß scheinbar komplex, in Wahrheit aber nur vertrackt und umständlich. Das liegt an der Prämisse - die Sprache des Autors ist ganz verständlich. Und die Prämisse ist: Sache der Kunst wäre es (irgendwie), 'uns mit Hilfe von Bildern über unsere Welt zu verständigen'. Und es ist klar: Wo es um Verständigen geht, wird ohne diskursive Rede nichts zu machen sein. Und mit diskursiver Rede wird zum Zwecke der Verständigung am meisten zu erreichen sein, wenn sie sich an die Schärfe des Begriffes hält und auf Bilder ganz verzichtet. Zum Zweck der Verständigung haben wir die Wissenschaft. Wenn man Kunst überhaupt braucht - was diskutabel ist -, dann jedenfalls zur Verständigung nicht.
Wenn die Bilder aber zur Verständigung über die Welt dienen sollen, dann müssen sie, wie der Begriff in diskursiver Rede, eine identifizierbare Bedeutung haben, die man aus ihnen lesen kann, so als hätte sie einer hinein geschrieben. Ja, und so war es auch in der Kunst bis zur Renaissance, und auch seither hat die Kunst sich erst langsam und unter Wehen aus ihrer Befangenheit in den mondänen Bedeutungen gelöst. Ich habe zu zeigen versucht, wie es insbesondere die Landschafts-Malerei war, die es erlaubt hat, das ästhetische Moment der Kunst von seinen thematischen Verstrickungen zu entbinden. Sie zu befreien aus dem engstirnigen Dogma, sie habe 'der Verständigung über die Welt' zu dienen!
Die Freisetzung des Ästhetischen aus den Zweckmäßigkeiten ist ein Gewinn und kein Verlust. Und unter diesem Gesichtspunkt hat die zeitweilige Aufgabe der Gegenstände in der Malerei des zwanzigsten Jahrhundert in der Tat zu einer Verarmung geführt - aber ganz anders, als Peter Bürger es sich erklärt. Sache der Kunst ist es nicht, an der Stelle der von Zwecken verödeten Welt eine andere, schönere zu erfinden: auch dazu sind die diskursiven Disziplinen besser geeignet; sondern neben und außer der sattsam bekannten Zweckmäßigkeit der Dinge ihren ästhetischen Schein zur Anschauung zu bringen. Dazu könnten wir sie brauchen in einer Welt, in der die Arbeit aufgehört haben wird, der Sinn des Lebens zu sein. Aber dienen dürfte sie auch und gerade dann nichts und niemandem.
J.E.
 William Turner, Brennendes Schiff auf hoher See
William Turner, Brennendes Schiff auf hoher See
Vilhelm Hammershøi, Wohnzimmer
Nota. - Versuchen wir mal ganz vorsichtig, uns dem Thema zu nähern. Lassen Sie's mich so sagen: Ich glaube, man wird der künstlerischen Intention Cy Twomblys nicht gerecht, wenn man über seine Werke - und namentlich dieses - so viele Worte macht. Mit Norbert Schwontkowski mag das anders sein, viel habe ich von ihm noch nicht gefunden. Worte machen ist aber das Geschäft sowohl der Kunsthistoriker als auch der ästhetischen Theorie.
Bleibt die Frage, ob es so viele sein müssen.
Im vorliegenden Fall: Der Text ist bloß scheinbar komplex, in Wahrheit aber nur vertrackt und umständlich. Das liegt an der Prämisse - die Sprache des Autors ist ganz verständlich. Und die Prämisse ist: Sache der Kunst wäre es (irgendwie), 'uns mit Hilfe von Bildern über unsere Welt zu verständigen'. Und es ist klar: Wo es um Verständigen geht, wird ohne diskursive Rede nichts zu machen sein. Und mit diskursiver Rede wird zum Zwecke der Verständigung am meisten zu erreichen sein, wenn sie sich an die Schärfe des Begriffes hält und auf Bilder ganz verzichtet. Zum Zweck der Verständigung haben wir die Wissenschaft. Wenn man Kunst überhaupt braucht - was diskutabel ist -, dann jedenfalls zur Verständigung nicht.
Wenn die Bilder aber zur Verständigung über die Welt dienen sollen, dann müssen sie, wie der Begriff in diskursiver Rede, eine identifizierbare Bedeutung haben, die man aus ihnen lesen kann, so als hätte sie einer hinein geschrieben. Ja, und so war es auch in der Kunst bis zur Renaissance, und auch seither hat die Kunst sich erst langsam und unter Wehen aus ihrer Befangenheit in den mondänen Bedeutungen gelöst. Ich habe zu zeigen versucht, wie es insbesondere die Landschafts-Malerei war, die es erlaubt hat, das ästhetische Moment der Kunst von seinen thematischen Verstrickungen zu entbinden. Sie zu befreien aus dem engstirnigen Dogma, sie habe 'der Verständigung über die Welt' zu dienen!
Die Freisetzung des Ästhetischen aus den Zweckmäßigkeiten ist ein Gewinn und kein Verlust. Und unter diesem Gesichtspunkt hat die zeitweilige Aufgabe der Gegenstände in der Malerei des zwanzigsten Jahrhundert in der Tat zu einer Verarmung geführt - aber ganz anders, als Peter Bürger es sich erklärt. Sache der Kunst ist es nicht, an der Stelle der von Zwecken verödeten Welt eine andere, schönere zu erfinden: auch dazu sind die diskursiven Disziplinen besser geeignet; sondern neben und außer der sattsam bekannten Zweckmäßigkeit der Dinge ihren ästhetischen Schein zur Anschauung zu bringen. Dazu könnten wir sie brauchen in einer Welt, in der die Arbeit aufgehört haben wird, der Sinn des Lebens zu sein. Aber dienen dürfte sie auch und gerade dann nichts und niemandem.
J.E.
 William Turner, Brennendes Schiff auf hoher See
William Turner, Brennendes Schiff auf hoher See